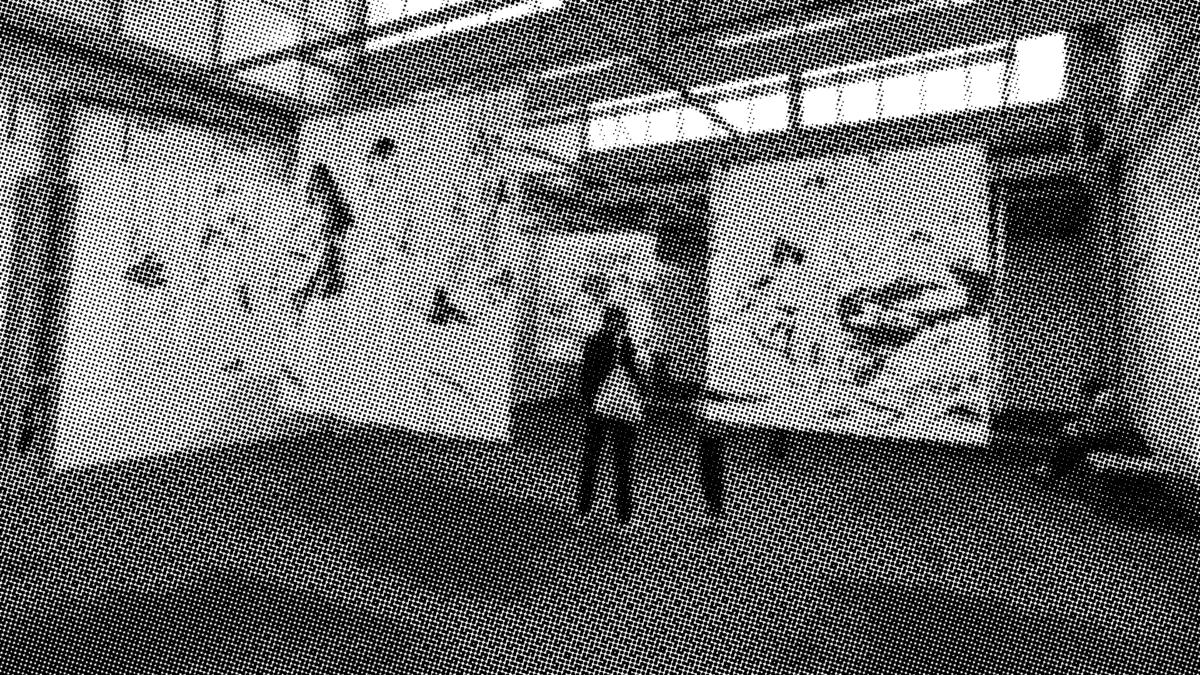Nach der documenta ist vor der documenta
Hans Eichel im Gespräch mit Sonja Rosettini und Helmut Plate von Welt.Kunst.Kassel
Das Interview ist im Original veröffentlicht auf der Website von Welt.Kunst.Kassel (www.welt-kunst-kassel.de)

Die documenta ist die weltweit wichtigste Ausstellung für Gegenwartskunst, die Auskunft über Themen, Diskurse und Ästhetik der Kunst in ihrer Zeit gibt. Wie keine andere Großausstellung verbindet die documenta immer wieder Tendenzen der globalen Welt mit ihrem Standort Kassel. Welt.Kunst.Kassel. hat Hans Eichel eingeladen, um mit ihm über die vergangene documenta fifteen und die Kunst in Kassel zu sprechen. Im Interview erzählt er von seinen documenta-Erfahrungen, spricht über Politik, Kunst und seineLeidenschaft für die documenta.
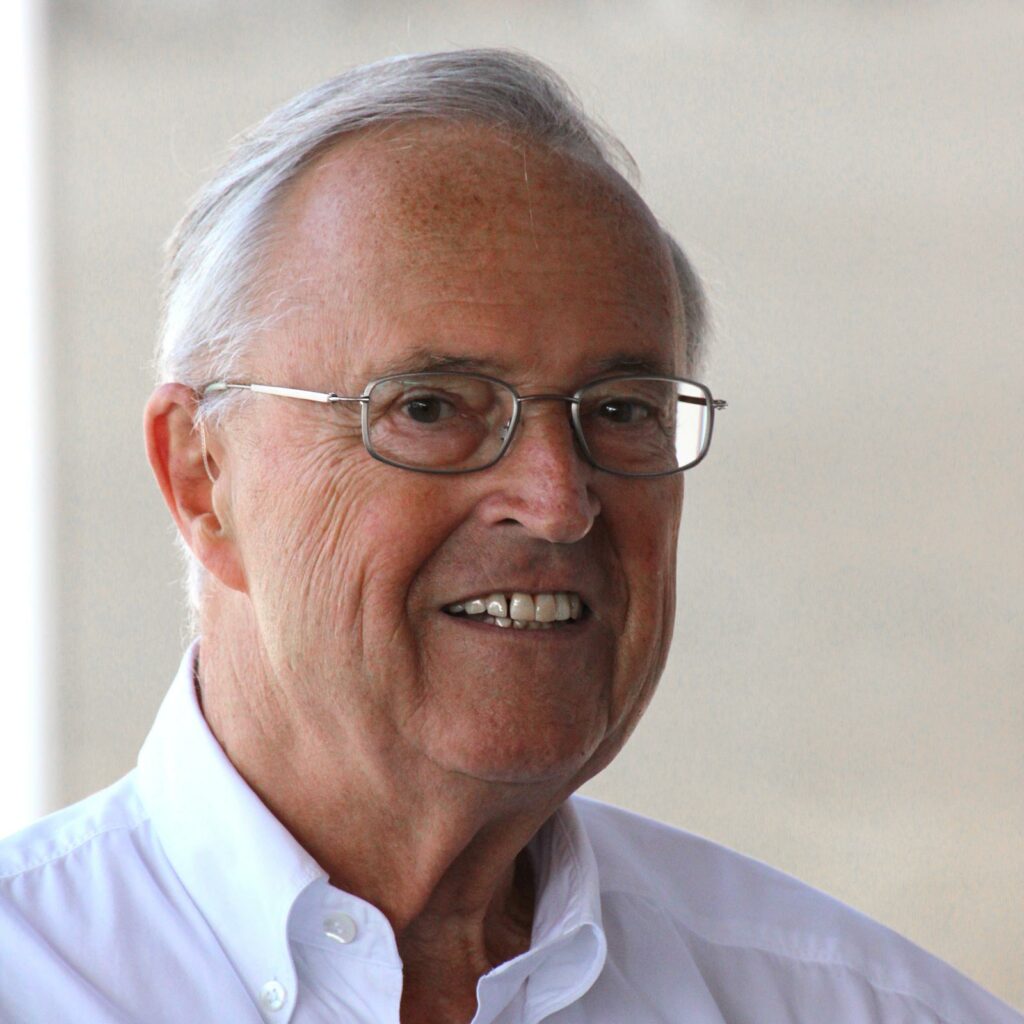
____
W.K.K.: Ihr Herz schlägt gewissermaßen für die documenta. Wie kein anderer haben Sie Partei für die documenta ergriffen. Sie haben auch sehr schwierige Zeiten in der documenta-Geschichte erlebt. Ich denke da z.B. an das Defizit, das Harry Szeemanns documenta 5 verursacht hat.
H.E.: Ja, das war zunächst eine für die Weiterexistenz der documenta bedrohliche Krise. Der Aufsichtsrat wollte Harry Szeemann, ein äußerst gewissenhafter Mensch übrigens auch beim Umgang mit Geld, persönlich für das Defizit seiner documenta verantwortlich machen. Das rief weltweit heftige Reaktionen hervor. Museumsdirektoren drohten, keinerlei Leihgaben mehr nach Kassel zu schicken, Kuratoren wollten künftige documenta-Ausstellungen boykottieren, Kunstkritiker ebenso. Der Aufsichtsrat gab schließlich nach, die Krise war abgewendet. Dabei hätte man von vornherein wissen können, dass solche Kunstereignisse, die so stark auf Eintrittsgelder und Sponsorenmittel angewiesen sind, immer ein finanzielles Risiko bedeuten. Über ihre künstlerische Bedeutung sagt das nichts aus. Die d5 z.B. gilt längst als eine der wichtigsten Ausstellungen in der bald siebzigjährigen Geschichte dieser Weltausstellung.
Das Defizit der d5 war, gemessen am Ausstellungsetat, etwa so groß wie 2017 das Defizit der d14. Hätte man 2017 die Erfahrungen beherzigt, die der Aufsichtsrat 1972 machen musste, hätte man sich die Skandalisierung dieses Defizits erspart und so die documenta vor einem Rufschaden bewahrt.
____
W.K.K.: Herr Eichel, Sie sind ein ausgezeichneter Kenner der documenta und als Kasseler Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der documenta GmbH 1975–1991 waren Sie selbst unmittelbar in eine schwierige Entwicklungsphase der Großausstellung involviert. Sie haben viele documenta Ausstellungen besucht und einige aktiv begleitet, haben selber als documenta-Guide gearbeitet. Welche war Ihre erste documenta, die Sie besucht haben?
H.E.: Ich habe alle documenta-Ausstellungen erlebt, auch die erste schon, 1955. Mein Vater war Architekt und Maler, sehr an der documenta interessiert, nahm mich mit. Aber klare Erinnerungen besitze ich erst an die zweite documenta (1959).
____
W.K.K.: Wie konnte die documenta die bedeutendste Ausstellung der Gegenwartskunst, das Forum der globalen Kunstgemeinde werden? Welches waren die Bedingungen dafür und wie kann das so bleiben?
H.E.: Arnold Bode hatte von Anfang an die documenta als periodisch wiederkehrende internationale Kunstausstellung gedacht. In den 1970er Jahren skizzierte er dann schon ihre Globalisierung. Er hat eben immer groß gedacht. Und so haben sich die documenta-Verantwortlichen, bei allen Fehlern, die sie auch begingen, schließlich immer verhalten.
1972 leitete zum ersten Mal ein Externer, der Schweizer Harald Szeemann, die Ausstellung. 1992 versammelte dann Jan Hoet, belgischer documenta-Leiter, erstmals Künstler von allen Kontinenten in Kassel. 1997 erklärte schließlich Catherine David, die erste Frau an der Spitze der documenta, die Kunstausstellung zur Weltausstellung. Seit 2002 gab es dann auch Ausstellungsorte außerhalb Deutschlands, auch auf anderen Kontinenten.
Die Bedingungen dafür, dass die documenta das Forum der globalen Kunstgemeinde, das bedeutendste Ereignis der Gegenwartskunst, bleibt, sind klar: Die künstlerische Leitung muss im Rahmen des Grundgesetzes vollkommen frei sein, niemand darf ihr reinreden. Alle künstlerischen Entscheidungen müssen ausschließlich in der globalen Kunstgemeinde getroffen werden. Das bedeutet: Eine hochkarätige internationale Findungskommission schlägt die künstlerische Leitung vor, die documenta-Leiter machen den Vorschlag für die Besetzung der internationalen Findungskommission. Der Aufsichtsrat übernimmt diese Vorschläge. Es findet also keinerlei politische, staatliche Einflussnahme statt. Das ist einmalig weltweit bei internationalen Kunstereignissen. Das ist die Voraussetzung für die herausragende Bedeutung der documenta.
____
W.K.K.: Wenn Sie die bisherigen documenta-Ausstellungen Revue passieren lassen: Wie ordnen Sie die documenta fifteen ein? Was hat Ihnen gefallen? Was hat Ihnen weniger gefallen? Haben Sie persönlich ein Lieblingskunstwerk bei der documenta fifteen gehabt?
H.E.: Die documenta fifteen ist einen großen Schritt weiter zur Globalisierung gegangen. Erstmals verantwortete ein Kuratoren-Kollektiv aus dem „globalen Süden“ das Weltkunstereignis. Das bestimmt ihre bleibende Bedeutung.
Gefallen hat mir der heitere, auf gemeinsames Tun orientierte Geist. Es ging nicht nur um Probleme, sondern um gemeinschaftlich erdachte und erarbeitete Lösungen.
Nicht gefallen hat mir die Unfähigkeit der documenta fifteen zur zugleich nachdenklichen wie offensiven Auseinandersetzung mit ihren Kritikern beim Thema Antisemitismus.
Mein Lieblingswerk dieser documenta war das ruruhaus. Es verkörperte mit seiner Offenheit, dem herrschenden kreativen Geist, der Bereitschaft zum hierarchiefreien Diskurs und der fröhlichen Geselligkeit den Geist dieser documenta wie kein anderer Ort, kein anderes Kunstwerk. Das ruruhaus hätte erhalten und weiterentwickelt werden müssen.
____
W.K.K.: Herr Eichel, Sie haben in den vergangenen Monaten die Konzentration auf die Antisemitismus-Debatte beklagt und mit scharfen Mitteilungen das bundesweite Medieninteresse wieder auf sich gezogen. Die Bewertung der documenta fifteen in den meisten deutschen Feuilletons war anfangs durchweg positiv bis euphorisch. Das änderte sich schlagartig nach der Entdeckung der antisemitischen Darstellungen in „People’s Justice“. Von da an berichteten die meisten Medien lange nicht mehr über Inhalte und Konzepte der documenta fifteen, sondern fast nur noch über den „Antisemitismus-Skandal“.
Es war in der öffentlichen Wahrnehmung eine turbulente documenta, ausgelöst durch diese Vorwürfe, die sich ja bis zum Ende der documenta fifteen und darüber hinaus zogen. Wie hätte Ihre Krisenintervention ausgesehen? Was wäre Ihr Rat gewesen, um die Eskalation zu vermeiden?
H.E.: Ich glaube nicht, dass diese Eskalation zu vermeiden war. Die Weichen dazu waren seit Anfang Januar 2022, also lange vor Beginn der documenta gestellt. Wir haben die Ausstellung nicht nach ihren Inhalten befragt, sondern ihr unsere Frage: Wie hältst Du es mit dem Antisemitismus, wie hältst Du es mit Israel im Konflikt mit den Palästinensern, gestellt und uns dann auf ihre Konzepte, ihre Anliegen nicht wirklich eingelassen. Tania Bruguera, die weltbekannte kubanische Künstlerin hat das zu Recht kritisiert.
____
W.K.K.: War es unter den gegebenen Umständen ein Fehler, ein Kuratoren-Team zu wählen?
H.E.: Nein. Die Entwicklung in der globalen Kunstszene legte es nahe, erstmals ein Kollektiv mit der Leitung der Ausstellung zu betrauen. Die Findungskommission hat das überzeugend begründet. Das Kollektiv hat sich aber zu wenig auf die Besonderheiten der deutschen Situation eingelassen. Und viele Feuilletons in Deutschland und vor allem die Politik in Deutschland waren überhaupt nicht willens und wohl zum Teil auch gar nicht in der Lage, sich auf die ganz neuen Herausforderungen durch diese documenta einzustellen.
____
W.K.K.: Unter anderem ist durch Wortmeldungen zahlreicher außenstehender Kritiker vor allem auch von Politikern, die sogar den Abbruch der documenta fifteen forderten oder die Verlegung in eine andere Stadt und nicht zuletzt durch die in großen Teilen negative Presse der documenta ein nicht unerheblicher Imageschaden entstanden. Sehen Sie Möglichkeiten der Reparatur?
H.E.: Nur allmählich und durch beharrliche Wiederholung der Tatsachen. Boris Rhein, der Hessische Ministerpräsident hat Recht: Die documenta fifteen war zu 99,9 % nicht antisemitisch. Wenn wir in Deutschland so wenig Antisemitismus hätten, würde der Zentralrat der Juden unser Land als eine Insel der Vorurteilslosen loben.
____
W.K.K.: Mit der Aufarbeitung des Antisemitismus-Themas beschäftigen sich gleich zwei Gremien. Noch während der documenta hat das siebenköpfige Experten-Gremium mit der Vorsitzenden Nicole Deitelhoff seine Arbeit aufgenommen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Und das documenta Institut hat mit seinem Gründungsdirektor Prof. Dr. Heinz Bude und Prof. Dr. Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, ein zweijähriges Forschungsprojekt zur Analyse der Antisemitismus-Kontroverse begonnen. Begrüßen Sie diese Initiativen?
H.E.: Die Einsetzung des Expertengremiums unter Leitung von Frau Prof. Deitelhoff halte ich für grundsätzlich verfehlt: Die Gesellschafter Stadt Kassel und Land Hessen müssen auch nur jeden Anschein von Zensur vermeiden. Auch ist „betreutes Kuratieren“ der Tod der documenta, dafür finden sich keine hochrangigen Kuratoren. Das Wesen der documenta ist die Freiheit. Und auch die Besucher brauchen niemanden, der ihnen qua staatlicher Autorität sagt, was gefährlich ist an der Kunst, die gezeigt wird.
Im übrigen warte ich noch auf die Antwort des Expertengremiums an der Fundamentalkritik, die in ZEIT ONLINE an der „Wissenschaftlichkeit“ seiner Arbeit geübt worden ist.
Prof. Bude und Prof. Mendel haben eine Chance, zur Versachlichung der Debatte beizutragen, nachträglich.
____
W.K.K.: Glauben Sie, dass es notwendig ist, Veränderungen in der Geschäftsstruktur der documenta gGmbh, beispielsweise bei den Verantwortlichkeiten des Aufsichtsrates, der Findungskommission, im Verhältnis der Geschäftsführung zur künstlerischen Leitung zu initiieren?
H.E.: Nein. Die Verantwortlichkeiten sind klar. Die künstlerische Verantwortung liegt ausschließlich bei den Kuratoren, Organisation und Finanzen bei der Geschäftsführung, dem Aufsichtsrat und den Gesellschaftern. Jeder muss seine Verantwortung wahrnehmen, keiner darf sich in den Bereich des anderen einmischen.
____
W.K.K.: Soll der Bund Gesellschafter werden? etc …
H.E.: Das muss zuerst der Bund für sich selbst entscheiden. Kassel aber darf nichts von seinen 50 % Gesellschafteranteile abgeben. Das ist die einzige Garantie dafür, dass die documenta in Kassel bleibt.
____
W.K.K.: Insbesondere DIE GRÜNEN fordern ja solche Veränderungen, u. a. im 5‑Punkte-Plan von Frau Roth. Oder die Alt-Grünen stellen sich eine andere documenta-Zukunft vor, fordern neue Strukturen, mehr Öffentlichkeit und einen Beirat für die Kuratoren. Reinhold Weist hat ein Papier verfasst zur Be- und Aufarbeitung nach der d 15. Festzustellen ist, dass die Politik und einige Interessenverbände mehr und mehr Einflussnahme auf die Institution documenta wünschen.
H.E.: Der Vorschlag von Frau Roth, der documenta eine ähnliche Struktur wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verpassen mit Aufsichtsgremien, in denen alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen vertreten sind, wäre der Tod der documenta. documenta ist frei und radikal subjektiv. Darin liegen ihre enormen Chancen, aber auch ihre großen Risiken. Wer keine Risiken will, kann keine documenta machen.
Die Vorschläge mancher, keineswegs aller Grünen, zeugen von der Unkenntnis der documenta. Sie würden die documenta ruinieren. Und staatlicher und politischer Einfluss hat in dem Weltkunstereignis nichts zu suchen.
____
W.K.K.: Sie haben gekämpft für die documenta wie kein anderer. Ich erinnere an Ihre Stellungnahme gemeinsam mit Wolfram Bremeier, Bertram Hilgen und Christian Geselle. Sie haben auch zahlreiche Interviews in der überregionalen Presse gegeben. Sie sind aus der Deutsch-Israelischen Gesellschaft ausgetreten…
Sie haben eine Bekenner-Petition mit dem Titel: DOCUMENTA FIFTEEN: DANKE! mit Dr. Wendelin Göbel initiiert, mit dem Ziel einer Würdigung der documenta fifteen. Die Petition hat 1.753 Unterstützer. 1.309 aus dem Regierungsbezirk Kassel plus 426 Auswärtige.
Sie haben eine WebSite in Form eines Bürgerforums gemeinsam mit Prof. Siebenhaar eingerichtet. „Bürger-Bündnis – d15.de“. Die HNA mit Frau Fraschke, Herrn Lohr und Herrn von Busse, haben saubere und gut recherchierte Beitrage gebracht. In der Debatte waren aus Kassel Christian Kopetzki und Miki Lazar populär vertreten.
H.E.: Die documenta braucht viele engagierte Verfechter, sonst wird sie nicht überleben.
____
W.K.K.: Kunst und Politik sind seit jeher untrennbar miteinander verbunden, und doch stellen sie ihr Verhältnis wechselseitig immer wieder neu in Frage. „Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit“, vermerkte Friedrich Schiller. Ohne Freiheit keine Kunst. Wie politisch ist Kunst in Deutschland? Und wo sind der Kunst Grenzen gesetzt?
H.E.: Ich will Schiller widersprechen. Auch in Diktaturen gibt es Kunst. Das hat uns die documenta fifteen, z.B. mit der Präsentation von Kunst aus Kuba gezeigt. Diese Kunst ist meist direkt politisch, agitiert gegen die bestehenden Verhältnisse, die Künstler verstehen sich zugleich als Aktivisten.
Und doch hat Schiller auch Recht. Kunst, die in Freiheit gedeiht, ist niemals eindeutig, niemals einfach agitatorisch, sie ist komplex, lässt verschiedene Deutungen zu. Um diese Kunst zu retten, müssen wir auch in Deutschland, auch für die documenta um die Kunstfreiheit kämpfen, wie sie Art. 5, 3 des Grundgesetzes garantiert. Nur dort, nur am Schluss im Strafrecht liegen die Grenzen der Kunst, nicht z.B. bei den Erwartungen gesellschaftlicher Interessengruppen.
____
W.K.K.: Wie bewerten Sie das Spannungsverhältnis von Kunst und Politik?
H.E.: Kunst ist niemals affirmativ, sie bejubelt nie einfach bestehende Verhältnisse. Sie befragt sie auf ihre negativen und positiven Möglichkeiten. Insofern ist sie gegenüber Politik, die meist auf irgendeine Form von Bewahrung des Bestehenden gerichtet ist, subversiv. Das spüren die politisch Verantwortlichen, deswegen versuchen sie, die Kunstfreiheit einzuschränken, in Diktaturen sowieso. Aber auch in Demokratien gibt es diese Versuchung.
____
W.K.K.: Hat Kunst heute einen Einfluss auf die Gesellschaft? Haben Künstler Einfluss auf die politische Debatte in Deutschland? Denken Sie, dass die aktuelle politische Situation einen großen Einfluss auf die Kunst hat?
H.E.: Ich sehe nicht, dass Künstler gegenwärtig stärker Einfluss auf die politische Entwicklung zu nehmen versuchen. Zu Willy Brandts Zeiten z.B. war ihr politisches Engagement sehr viel größer und sichtbarer. Brandts Friedenspolitik und sein Einsatz für den „globalen Süden“ regten die Fantasien aller an, die über die bestehenden Verhältnisse hinaus denken wollten.
Umgekehrt gibt es heute eine Tendenz der Politik und einzelner gesellschaftlicher Gruppen, die Kunst- und die Meinungsäußerungsfreiheit einzuschränken. Die Diskussion um die documenta fifteen war — und ist z.T. immer noch — ein besonders erschreckendes Beispiel dafür.
____
W.K.K.: Was sagen Sie als Politiker zur derzeitigen politischen Lage? Leben wir in einer gespaltenen Gesellschaft? Die Situation wirkt verfahren, die Lager zerstritten, der gesellschaftliche Diskurs gespannt. Haben Sie eine Idee, wie wir dort wieder herauskommen?
H.E.: Wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend diskursunfähig wird. Man denkt immer mehr nur noch in Schwarz-Weiß, Grautöne, vermittelnde Positionen scheinen immer weniger Chancen zu haben. Gegensätze, Unvereinbarkeiten können offenbar immer noch friedlich ausgehalten werden. Das aber ist erst Demokratie in Bestform. Wie wir aus dieser Verhärtung wieder herauskommen? Sprachlich abrüsten, geduldiges Zuhören, Nachdenken und unaufgeregtes Argumentieren — mehr fällt mir dazu nicht ein. Hoffentlich reicht das auf Dauer.
____
W.K.K.: Grundsätzlich stellt sich die Frage: Träumen Sie von einer homogeneren Gesellschaft? Sollte es überhaupt ein Ziel sein, zu einer einigenden Gesellschaft zu kommen? Oder sollten wir im Sinne einer Vielfalt vielmehr lernen, mit Unterschieden konstruktiv umzugehen?
H.E.: Die Schere zwischen arm und reich hat sich viel zu sehr geöffnet bei uns, aber auch weltweit. Das müssen wir dringend ändern, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu bewahren und wieder zu stärken. Kulturelle, ethnische, weltanschauliche Vielfalt dagegen ist Reichtum, wir müssen sie entfalten, kreativ nutzen, keinesfalls zwangsweise einschränken. So machen wir das Zusammenleben im globalen Dorf lebenswert. Davon handelte übrigens auch die documenta fifteen.
____
W.K.K.: Kann Kultur dabei helfen, diese Widersprüche und Spaltungen zu überwinden? Ist es überhaupt Aufgabe von Kunst, gesellschaftliche Wunden zu heilen oder wäre diese Erwartung nicht vielmehr eine heillose Überforderung? Oder sollte Kulturpolitik unter Umständen sogar mehr Gewicht in der politischen Landschaft haben?
H.E.: Bei Kunst und Kultur geht es um den kreativen Umgang mit Widersprüchen. Eine von diesem Verständnis geprägte Kulturpolitik sollte eine viel größere Rolle in unserem Zusammenleben spielen. Aber überstrapazieren darf man seine Erwartungen an ihre glück- und friedensstiftende Wirkungen nicht.
____
W.K.K.: Wir bedanken uns bei Ihnen für das Gespräch.