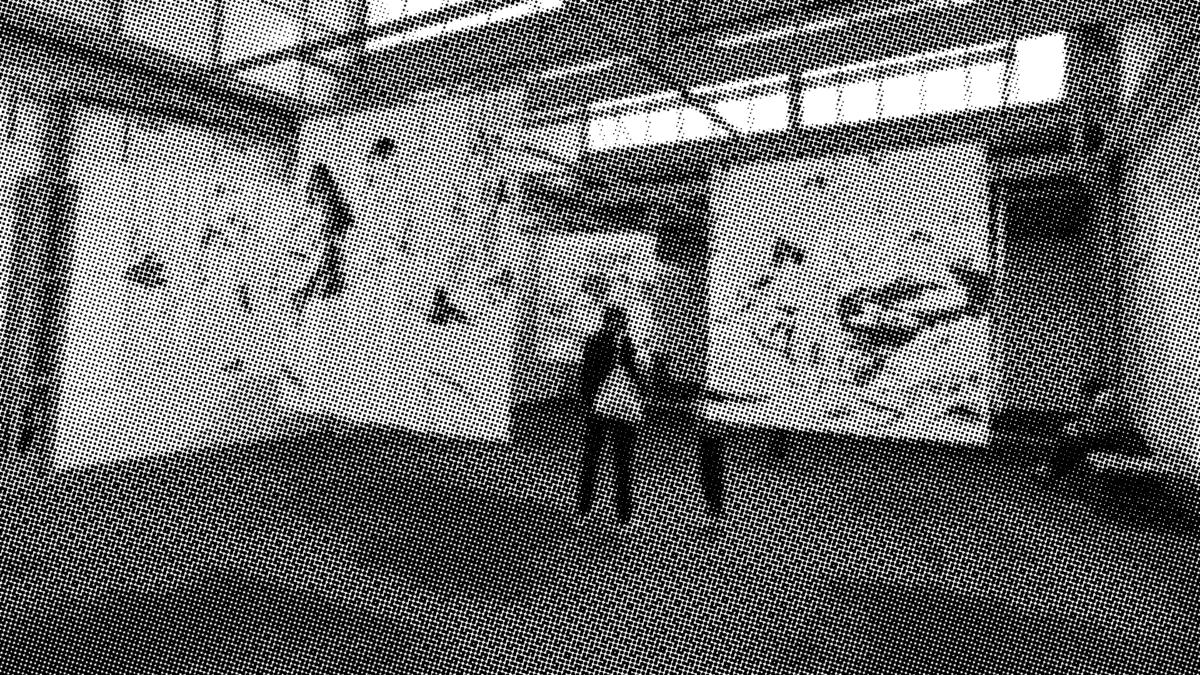Telefonisch
I: Sie haben gesagt, Sie haben die documenta schon mehrmals besucht. Was ist denn am meisten hängengeblieben von den Besuchen?
M: Vielleicht muss ich vorwegschicken: Wir wohnen erst seit fünf Jahren in Kassel, und es ist für uns die erste documenta, die wir als Einwohner der Stadt Kassel sehr intensiv erleben. Also ich habe keinen Vergleich zu vorherigen Veranstaltungen. Das müssen dann sicherlich andere machen, die das besser überblicken können. Also erstmal natürlich, dass eine Stadt Kassel, die jetzt 200.000 Einwohner, die jetzt sozusagen so sehr im Scheinwerferlicht steht, dass davon auf diesem Planeten Menschen sich aufmachen in die Mitte Deutschlands, das ist natürlich eine tolle Atmosphäre, dieses große, internationale Publikum, die vielen Menschen, eine komplett andere Atmosphäre in der Stadt. Und das Wetter war ja warm, sommerlich, sehr sommerlich, so dass man viel auch draußen machen konnte. Das ist auch ein Bild in der Stadt, was erstmal auch ansprechend ist, weil es einfach sehr bunt und farbig und fröhlich – ich finde diese Atmosphäre macht schon sehr viel aus. Ich sag mal, man geht nicht auf ein Messegelände abseits von der Stadt und dann erst recht außerhalb einer Innenstadt, sondern das ist ja mitten in Kassel. Das ist denke ich mal ein wichtiges Element. Und wenn ich die Zahlen richtig verstanden habe, dann dürfen wir damit rechnen, dass wir gleich, vergleichbare Besucherzahlen haben werden wie beim letzten Mal. Das wären dann irgendwo zwischen 800.000 und 900.000, so in der Größenordnung, und das wäre für sich genommen – ich meine, wir sind noch nicht aus Corona raus so richtig, und viele sind sicherlich zurückhaltend, was Reiserei angeht. Das ist so das Grundsätzlich-Atmosphärische. Dann würde ich sagen, dass in Summe, also was ich gehört habe, so mit vielen Bekannten, über die Messe [die documenta] gegangen, ich bin bei [Club/Verein] aktiv, wir hatten Besucher aus dem Ausland in Kassel, mit denen wir auf der documenta waren, und die Rückmeldung war durchweg positiv. Insofern – Begeisterung ist jetzt vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall: Das, was sie gesehen haben, hat den Menschen gefallen. Und dann ist natürlich die Frage: Was hat ihnen da gefallen? Und da würde ich mich dann anschließen: dass es sehr viele Denkanstöße liefert, Dinge, die einem vielleicht so nicht bewusst sind. Wenn ich am Beispiel an „Return to Sender“ in der Karlsaue denke, das Geschäft mit den Altkleidern da beschrieben wird, was es mit Menschen in Afrika ausmacht. Dass da eben das alte Zeug, nenne ich es mal, da ankommt. Das ist aber ein Beispiel von sicherlich vielen anderen möglichen. Das hätte ich so nicht gedacht – was mache ich denn jetzt damit, auch so privat. Zu reflektieren: Wo stehe ich denn da, was habe ich bisher gemacht, und ist das denn gut? Das sind so Dinge, die sehr positiv sind. Das andere ist dann von den Locations her. Was sehr positiv, auch ich persönlich sehr positiv finde: Ich wohne in der Unterneustadt, also in dem Stadtteil, der unmittelbar an der Fulda liegt – ich genieße das sehr, am Fluss zu wohnen. Das ist ein Element, das ich sehr positiv finde, das war ja auch eines der Anliegen: Stadtzentrum Kassel, aber eben mit Ausstrahleffekten räumlich in den Kasseler Osten. Und die Fulda mit einzubeziehen. Mit der Spitzhacke, mit dem – ich nenne es jetzt mal Strandbad, und und und. Viele Elemente, um den Menschen das nochmal zu verdeutlichen: Hey, ihr wohnt an einem Fluss, das ist grün hier, und wir zeigen, wie es schöner sein kann. Das ist ein Element, das über den reinen Kunstbetrieb hinausgeht. In dem Biergarten „Ahoi“, da waren wir häufiger, das hat uns sehr gut gefallen, das gefällt uns immer noch sehr gut. Das waren auch ein paar Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Die alten Industriegelände sind ja immer attraktiv, von der Auswahl der Locations her sehr interessant, weil sehr abwechslungsreich. Dann St. Kunigundis als ehemalige katholische Kirche, dieses haitianische, beinahe Voodoo-Kunst, dann in einer ehemaligen katholischen Kirche, dieses besondere Ambiente für diese Ausstellungsobjekte, das fanden viele auch sehr interessant, weil das dann ja auch einen gewissen Spannungsbogen schon für sich bildet. Also da sind sehr viele Dinge, die mit den Locations, mit der Anordnung, kurze Wege, also jetzt relativ, das Hübner-Gelände sicherlich am weitesten weg, und St. Kunigundis, beide im Grunde aber auch wunderbar zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Insofern war das jetzt in Summe, was diesen infrastrukturell-logistischen Teil angeht, sehr positiv. Das, was sicherlich dem einen oder anderen irgendwann vielleicht auch zu viel wurde, ich bin jetzt ein bisschen auf der, ich will nicht sagen Kritik, aber auf der Anmerkungsseite, dass dieser erhobene Zeigefinger, dieses in den Spiegel gucken, und, sozusagen der globale Süden hält uns jetzt mal den Spiegel hin: ist OK, aber das war ja fast überall, egal, wo man hingegangen ist. Das ist dann jedes für sich OK. Aber wenn man jetzt so wie manche es ja machen, versucht, viel documenta in kurzer Zeit zu sehen – wir haben auch Besucher gehabt, wo wir dann zwei Führungen am Tag hatten, und das fühlt sich dann fast wie eine Überdosis an. Die Sozialkritik ist ja OK, und es ist ja auch alles richtig, aber: Hey, Leute, jetzt ist auch mal gut.
Manche haben es so formuliert, andere haben es vielleicht diplomatischer ausgedrückt, aber das war dann irgendwo auch ermüdend. Man will irgendwie auch einfach mal Spaß haben. Das man einfach mal sagt: Hey, wow. So ein bisschen was Entspanntes. Da war wenig Entspanntes dabei. Dann ging es um die Bora Bora, dann ging es um Südafrika, dann ging es um die „Return to Sender“. Im Hübner-Gelände waren ja sehr, sehr viele. In Dänemark die Geflüchteten. Jedes für sich genommen war es wert, separat wahrgenommen zu werden. Aber wie gesagt: Wenn man versucht, das an einem Tag reinzudrücken, dann ist die Dosis schon sehr hoch.
I: Und das ist jetzt gar nicht so sehr auf die Atmosphäre insgesamt bezogen, sondern auf das, was an Kunstwerken oder an Praxis gezeigt wurde?
M: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass viele dann einfach an der Stelle auch den Empfänger abschalten, und sagen: OK, ich habe die Botschaft verstanden, ich habe mich ja jetzt an zwei, drei Stellen damit auseinandergesetzt, sehe, dass es an anderen Stellen so ähnlich ist. Also blende ich das jetzt mal aus und guck mir mal die Sachen an, als solche. Was natürlich nicht im Sinne der Künstler ist, aber einfach der Anzahl der Objekte geschuldet ist. Und dann macht es insofern wieder Spaß, weil man dann einfach ein Stück weit den ernsten Hintergrund ausblendet. Das gelingt natürlich nicht immer, aber manchmal.
I: Ein interessanter Hinweis: Dass man das ausblenden kann. Aber hätten Sie sich das grundsätzlich anders gewünscht? Oder ist das etwas, wo Sie sagen: Na gut, da hat jeder die Hoheit darüber, wie er sich das auswählt?
M: Ja, das ist ja bei dieser Ausstellung, die so viele verschiedene Orte hat, wo wahrscheinlich sehr viele Besucher innerhalb von maximal zwei Tagen sich das anschauen: Man kann nie alles sehen. Und sicher muss ich dann eine Auswahl treffen, manche Dinge guckt man sich nur oberflächlich an, mit anderen beschäftigt man sich intensiv. Das muss man dann dem Besucher überlassen, da würde ich auch keine Vorgaben machen. Was ich damit sagen will, ist: Das ist jetzt keine leichte Kost im Sinne von Konsumkunst. Man geht da nicht einfach hin und sagt: Wow, schön! Bis hin zu: Würde ich mir das selbst in den Garten stellen? In die Wohnung hängen? Weil mich das einfach erfreut, der Anblick? Oder ich das einfach schön finde? Davon war jetzt sehr wenig. Bis hin zu der Frage, die ja am Ende jeder documenta steht, wie ich das gelernt habe: Was wollen wir Kasseler denn in der Stadt behalten? Da würde mir jetzt spontan nicht wirklich so ein herausragender Kandidat einfallen, im Sinne wie die Spitzhacke, oder letztes Mal der Obelisk. Das habe ich ja live miterlebt, die Diskussion. Wo alle sagen: Hey, den wollen wir behalten. Das ging ja nur darum: Wo steht das Ding dann langfristig? So was fällt mir jetzt hier nicht ein. Im Sinne von: Das müssten wir unbedingt in der Stadt halten. Vielleicht zeigt das Beispiel, dass es diesmal eine andere documenta war. Mit anderem Schwerpunkt, anderen Facetten. Ohne, dass ich jetzt auf die Antisemitismus-Debatte eingehe – das darf man nicht ausblenden, aber für den Moment mal, dann ist da nichts, wo ich sage, das müssen wir unbedingt da und da hinstellen, weil das einfach gut ist.
I: Aber auch, wenn es nicht unbedingt um die Antisemitismus-Debatte gehen muss. Gerade wenn Sie sagen, dass es die erste documenta ist, die Sie so bewusst erleben: Was für ein Bild hat sich denn aus diesen einzelnen Besuchserfahrungen und Rückmeldungen von der documenta als Ausstellungsinstitution in der Stadt Kassel ergeben? Wie sehen Sie die documenta da verankert, was ist die Bedeutung?
M: Ich meine, die Stadt nennt sich ja nicht umsonst documenta-Stadt, steht ja auch auf den Ortsschildern drauf. Das ist vielleicht ein sichtbares Zeichen dafür, dass das beim größten Teil der Bevölkerung, nicht bei allen, werden es ja nie, dass eben doch sehr viele Menschen überzeugt sind, dass die documenta ein wichtiges Element in der Stadt ist. Sie ist ja mit dem Abstand von fünf Jahren ja auch ein vergleichsweise seltenes Ereignis. Die Olympiade ist häufiger als die documenta. Sie ist in Kassel entstanden, die Kasseler sind stolz darauf, dass die documenta in Kassel entstanden ist und bis heute ihren Stellenwert hat. Sie hat überall in der Stadt Spuren hinterlassen, in vielerlei Hinsicht. Nicht nur rein oberflächlich-optisch, das ist ein Fixpunkt in der Stadtgesellschaft, im Leben in Kassel. Ich bin ja vor fünf Jahren gekommen, da waren gerade noch die letzten drei Tage documenta, die letzte documenta, dann der Abbau, die Diskussion danach: Wir haben Schulden gemacht. War das gut mit Athen oder nicht? Das beschäftigt die Stadtgesellschaft noch Monate danach. Die Leute engagieren sich, Leserbriefe in der Zeitung. Das ist wirklich etwas, das bewegt die Leute. Positiv wie negativ. Aber es gibt kaum Leute, die keine Meinung haben. Es ist einfach ein wichtiges Element. Das ist so als wenn die Olympiade immer in Kassel wäre. Also wenn man jetzt anfängt, darüber nachzudenken, ob die jetzt immer in Kassel sein muss, dann gehen da die Alarmglocken an.
I: Die Diskussionen haben ja stattgefunden. Haben Sie den Eindruck, dass die documenta, nicht nur, was den Antisemitismus angeht, sondern auch die Tatsache, dass da wenig Kunst im klassischen Sinne, oder wie Sie es genannt haben, Entspanntes ist – haben Sie den Eindruck, dass sich das Bild der documenta in der Stadt verändert hat?
M: Das weiß ich nicht. Ich glaube, man muss mal ein paar Tage Abstand dazu haben. Wenn man dann, und deswegen ist es glaube ich wichtig, dazu gleich auch noch ein paar Worte zu verlieren, wenn man dann dieses Thema Antisemitismus – wieviel Verantwortung tragen Künstler, künstlerische Kollektive und, und, und … das sind Dinge, die müssen dringend aufgearbeitet werden, aus vielen Gründen. Das ist das eine. Aber die documenta an sich stellt niemand in Frage. Die documentas waren immer sehr kontrovers. Das auch jetzt im Nachhinein in der ersten documenta Männer aktiv waren, die glaskar einen NS-Hintergrund hatten, und sich da als Unterstützer der freien Kunst geriert haben. Da gibt es schon immer wieder Widersprüche in der Geschichte der documenta. Da waren die Kasseler Bürger damals überhaupt nicht begeistert, als der Herr Beuys da 7.000 Granitblöcke auf den Friedrichsplatz geknallt hat, oder hat knallen lassen. Was dann ja Jahre gedauert hat, bis die dann vergraben waren. Jetzt sind alle stolz darauf, und das sieht man ja im Stadtbild sehr spektakulär, welche Spuren das hinterlassen hat. Jetzt sind alle stolz auf diese 7.000 Eichen, die 7.000 Bäume, die entstanden sind bzw. die gepflanzt wurden. Die ja auch sehr nachhaltig sind. Also das eine ist der Moment selber, das Verstörende, Überraschte, das Erstaunen, oder auch das Geschocktsein. Vieles wird dann auch nicht verstanden am Anfang. Mit Distanz und mit etwas größerer Distanz, wenn man dann die Entwicklung der Kunst danach reflektiert, stellt man fest, dass die documenta eben auch sehr viele Anstöße gegeben hat, wie sich Kunst dann entwickelt hat. So wie die documentas auch immer wieder wichtige Meilensteine in der Entwicklung der Kunst gebildet haben, so kontrovers sie dann zu dem Zeitpunkt auch diskutiert wurde. Das ist auch unstrittig. Das sagt ja jeder: „Also, die documenta, die muss ja zu Streit führen, sonst wäre es ja keine echte documenta.“ Jetzt mal grundsätzlich gesprochen. Der Antisemitismus ist natürlich jetzt das mit Abstand allerschlechteste Thema, mit dem man sich jetzt irgendwie ins Streitgespräch begeben sollte. Dafür braucht es eine klare Haltung. Und das ist jetzt sicherlich die größte Kritik, die man an der jetzigen documenta haben kann und muss: dass da nicht von vornherein glasklar kommuniziert wurde. Ich meine, dass die Institution documenta, dass der Anspruch einer documenta, das Nachwirken der documentas, das ist völlig unstrittig, und das ist auch gewollt. Da sind auch die Kasseler Bürger, die sich da nur ein bisschen mit beschäftigen, sind die wirklich stolz drauf.
I: Das ist der Eindruck, den ich auch habe. Aber dann vielleicht doch nochmal: Wie haben Sie persönlich denn die Antisemitismus-Debatte wahrgenommen?
M: Die Frage ist, wenn man … wo zieht man die Grenze zwischen künstlerischer Freiheit und geschichtlicher, historischer Verantwortung, die wir gerade auch in Deutschland haben, eingedenk unserer Geschichte. Es gab ja frühe Signale, so spätestens im Januar, das ist dann ja auch bei uns durch die lokale Presse gegangen, und überregional ist das ja sicher auch wahrgenommen worden, dass alle Beteiligten, ich will jetzt keinen besonders in Schutz nehmen, da sind viele beteiligt gewesen, Aufsichtsrat, auch die gGmbH, die politischen Akteure, die Künstler selber sicher auch, die Kollektive. Dass ihnen allen nicht bewusst war, wie sensibel … nein, das ist falsch formuliert. Das ist vielen bewusst, aber man hat nicht konsequent genug sich damit auch öffentlich auseinandergesetzt. Wo ist die Grenze, was ist akzeptabel, und was ist nicht akzeptabel? Warum ist es nicht akzeptabel? Da die Grenze zu ziehen, wo sich auch die künstlerischen Kuratoren orientieren müssen, zu sagen: „Ja, künstlerische Freiheit ist richtig, wollen wir auch. Und sie sollen auch alle Freiheiten haben. Aber die Freiheit muss an dem Punkt die Grenze haben, weil …“ Und das konsequenter einzufordern: „Leute, ja, das ist eure Verantwortung, und wir messen euch an eurer Verantwortung. Und wenn ihr der Verantwortung nicht gerecht werdet, liebe Kuratoren, dann werden wir uns da auch mit einbringen.“ Sage ich mal vorsichtig. Und das ist in der … zumindest, wie ich so wahrgenommen habe – ich weiß natürlich auch nicht viel, ich lese Zeitung und höre das eine oder andere, dieses sehr konsequente, sehr energische, auch wahrnehmbar Energische … da hätte man zumindest sicherstellen können, dass alle Aktiven in Kassel und um Kassel herum wahrgenommen werden als die, die das versucht haben, sagen wir mal, zu sortieren, auch Grenzen aufzuzeigen. Und wenn sich dann Kuratoren nicht daran halten, dann ist das sicherlich eine andere Diskussion, als wenn man sich letztlich vorwerfen lassen muss, man hätte sich eben nicht energisch genug darum gekümmert. Danach klingt es wie eine lahme Ausrede.
I: Nur um es auf den Punkt zu bringen: Es geht gar nicht darum, das Abhängen zu veranlassen, sondern Position zu beziehen, und dann zu sehen, was als Reaktion kommt. Sehe ich das richtig?
M: Ich benutze mal das Beispiel, weil das ja auch in der Zeit per Gerichtsurteil in die Öffentlichkeit gekommen ist, diese „Judensau“ da in der Kirche, in Wittenberg – ist das nicht, nee? Oder doch Wittenberg? Wo ja vor 700 Jahren die damaligen Erbauer eine „Judensau“ in diese Fassade eingebaut haben, unten aber eine Stele in der Kirche steht, die das in den Kontext bringt, kommentiert. Für das Gericht war das dann ausreichend. Es gibt aber trotzdem Leute, die sagen: „Hey, das sollte man aber trotzdem entfernen.“ Man kann das ja dann in ein Museum stellen, um all das zu dokumentieren. Dass es eben historisch gesehen Antisemitismus schon seit Langem gab, was man zu Beispiel an so einem … na und so weiter. Es gibt Leute, die sagen, hätte man dieses Banner nicht hängen lassen können? Dann hätte man ein großes Plakat daneben gemacht: „Achtung! Antisemitismus!“ Und hätte versucht, das zu erklären. Manche sagen, das wäre gut gewesen, dann hätte man sich da klar positioniert und hätte damit auch Gesprächsstoff geliefert. Andere sagen: „Das reicht nicht, man muss es abhängen.“ Es gibt da für beides Argumente, auch gute Argumente, und dagegen auch. Aber man hat das zu spät gemacht, und gerade das Projekt, was vor zwanzig Jahren entstanden ist, und schon an vielen Stellen wohl gehangen hat – kann keiner sagen, er hätte es nicht gewusst. Also, er kann das zwar sagen, aber dann muss man ihm vorwerfen, Du hast Dich nicht früh genug damit beschäftigt. Zumal es Signale gab. Das ist ein klarer Hinweis, dass da ein paar Leute ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. So nehme ich das wahr. Und den Vorwurf muss man machen, und dem kann man sich auch kaum entziehen. Da braucht es auch eine Aufarbeitung. Finde ich. Da finde ich, ist kommunikativ – ich bin da nur so Halb-Profi – auch vieles sehr unglücklich gelaufen, muss man im Nachhinein sagen, was das noch verstärkt hat. Dann fühlen sich Leute berufen, das dann aufzugreifen, da gibt’s dann natürlich Leute in der Hauptstadt, in der Landeshauptstadt, die meinen, sie müssten da auch was zu sagen. Warum? Weil da ja offensichtlich eine Lücke ist, die gefüllt werden will. Und dann wird die eben positiv oder negativ gefüllt, aber so ist das halt mit Lücken. Und das ist das Ding, das braucht sicherlich eine Aufarbeitung, das ist für mich unstrittig. Da lagen dann natürlich auch politische Elemente, die Roten und die Grünen mögen sich nicht leiden, und in Kassel ganz besonders nicht. Da gibt es auch noch verschiedene andere Schichten, die, wenn man das wie so eine Zwiebel auseinandernimmt … verschiedene Schichten zu Tage kommen. Die auch nicht helfen gerade.
I: Diese Ebenen sind mir im Verlauf auch immer bewusster geworden. Ich hätte noch als Hintergrund eine Frage: Wie stark ist denn Ihr persönlicher Bezug zu Kunst? Ist das etwas, wovon Sie sagen: „Das mache ich sowieso immer“, oder ist das etwas, wo Sie sagen: „Na ja, ist jetzt etwas, das ist jetzt eigentlich nicht so meins, aber ich nehm’s mal auch mit“?
M: Also, ich bin jetzt nicht so ein Biennale-Besucher, der jetzt von einer Ausstellung zur anderen pilgert, so nicht. Ich habe das jetzt deswegen … Wir haben uns auch auf die documenta gefreut, weil das auch einfach in Kassel lebt, einem für eine Zeit lang bewusst wird, wie wichtig diese documenta doch ist, ganz grundsätzlich. Und einmal diese Atmosphäre, deswegen hatte ich das eingangs auch erwähnt, das fanden wir einfach toll. Weil das auch ein anderes Kassel herausbringt, als das normale, sage ich mal, Kassel. Und das ist einfach spannend, auch unabhängig von der Kunst an sich. Aber wenn es dann da ist, und wir besuchen auch Museen und so, aber wir sind jetzt nicht die super intensiven Kunstanhänger, sage ich mal.
I: Ich bin mit meinen Fragen durch. Gibt es Sachen, die Ihnen noch auf den Nägeln brennen?
M: Ich meine, wir sind ja an ein paar Punkten vorbeigekommen. Aber wenn man mich jetzt fragt, oder wenn ich einen Artikel schreiben würde über die documenta aus Kasseler Sicht, dann würde ich immer sagen: Die documenta Punkt bleibt Punkt in Punkt Kassel Punkt, oder so ähnlich. Um einfach zu sagen: „Hey, die documenta hat eine Geschichte, die wechselvoll ist, sicherlich nicht immer gut war. Und hier war jetzt auch vieles nicht gut.“ Aber man darf überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen an der Institution documenta grundsätzlich und schon gar nicht daran, dass sie wenn, dann in Kassel stattfinden muss. Das ist das eine, und das andere: Selbstverständlich muss jetzt im Nachgang sauber aufgearbeitet werden, mit Blick auf die dann nächste documenta. Weil in einem Jahr, eineinhalb, fängt ja der Prozess der Auswahl der nächsten Kuratoren an. Das muss vorher sortiert sein, damit klar ist, was man beim nächsten Mal anders machen muss. Und insofern werbe ich dafür, dass wir das in diesem Jahr aufarbeiten, und zwar wirklich sauber, und nicht politisch koloriert, sondern sachlich – schwierig bei dem Thema, aber auch in der Klarheit muss das gemacht werden. Damit da auch keine Zweifel hängenbleiben. Und damit dann auch der Blick nach vorne zur nächsten documenta irgendwann wieder mit Vorfreude und Spannung möglich ist. Das eine geht nicht ohne das andere. Aber es darf keinen Zweifel daran geben: Die nächste documenta ist 2027 in Kassel.
I: Ein schönes Schlusswort.
M: Es ist immer schwierig, mit Besucherzahlen zu argumentieren. Ich habe in der Schule mal gelernt: Abstimmung mit den Füßen. Aber dann müsste ja die Bildzeitung immer recht haben, weil es eine Menge Leute gibt, die Bild-Zeitung kaufen – oder früher gekauft haben. Das macht ja nicht richtig, was drinsteht. Aber dass so viele Menschen nach Kassel gepilgert sind, beweist, dass es eben auch eine wichtige Institution in der Kulturlandschaft weltweit ist. Und der Anspruch ist richtig, aber auch der Anspruch an hohe Qualität, und ich sag mal an ordentliche Aufarbeitung. Wenn man Weltmeister sein will, oder bei dieser Champions League der Kunstveranstaltungen mitspielen will, dann braucht es auch ein sehr, sehr professionelles Umfeld, wie in jeder anderen, ich sage mal, Sportart.
I: Auch noch ein wichtiger Punkt!